Ich bin eine Waldorf-Quereinsteigerin. Mein vier Jahre jüngerer Bruder besuchte bereits den Waldorfkindergarten, als ich auf der Warteliste plötzlich vorrutschte und kurzfristig mitten im Schuljahr in die vierte Klasse wechseln konnte. An einem trüben Dezembertag im Jahr 1983 war es so weit: Ich trat die nicht unbeträchtliche Reise in meine neue Schule an – damals noch in Baracken in Roisdorf untergebracht, einige Monate später stand dann der Umzug nach Bonn-Tannenbusch an. In direkter Nachbarschaft zur dortigen Hauptschule, die man heute wohl als Brennpunkt-Schule bezeichnen würde, bezogen die Bonner Waldis ihr neues Domizil, mit „appen Ecken“ und allem, was dazu gehört.
Vorurteile zur freien Auswahl
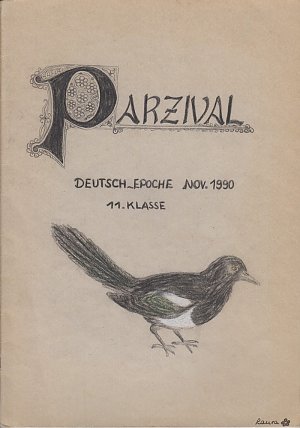
In meinem direkten Umfeld, ob bei den Nachbarkindern im Dorf oder auch im Bekanntenkreis meiner Eltern, sorgte mein Schulwechsel größtenteils für Unverständnis, manchmal auch kaum verhohlenen Spott. Es gab eine ganze Reihe Vorurteile zur freien Auswahl: die Waldorfschule sei wahlweise für behinderte Kinder oder die verzogenen Sprösslinge reicher Familien geeignet, die es auf anderen Schulen nicht schaffen würden. So oder so galt es als höchst zweifelhaft, ob man da überhaupt etwas Gescheites lernen könne. Ich begegnete diesen Vorurteilen leicht resigniert – die Zeiten, in denen Waldorfschüler:innen selbstbewusst Scherze übers „Namen tanzen“ machen, waren noch lange nicht in Sicht. Anders als heute, wo zumindest im urbanen Umfeld eine Vielzahl privater Schulen ganz selbstverständlich zur Schullandschaft gehören, gab es damals ja höchstens noch kirchliche Schulen. Die waren selbstverständlich anerkannt. Die Waldorfschulen eher nicht so.
Besonders nervig fand ich es, dass fast jeder auf die Information, dass ich auf eine Waldorfschule gehe, irgendeine wilde Geschichte auspackte – häufig aus zweiter oder dritter Hand erfahren –, in der ein bedauernswertes Kind unter irgendeiner sadistischen Waldorflehrerin zu leiden hatte oder ganz allgemein völlig unvorbereitet ins „richtige“ Leben entlassen wurde, wo er oder sie natürlich in Bausch und Bogen scheiterte. Abgesehen davon, dass da vermutlich oft maßlos übertrieben wurde, käme wohl niemand auf die Idee, aufgrund solcher tragischer Einzelfälle, die es selbstverständlich in jedem Schultyp gibt, grundsätzlich vernichtende Urteile etwa über alle Gymnasien dieser Welt zu fällen.
Klare Fronten
Die Schule in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn war ein relativ geschlossener, größtenteils gutbürgerlich geprägter Kosmos mit einem durchaus konservativen anthroposophischen Wertesystem. Es waren die 80er Jahre und die Fronten klar: Fernsehen war ebenso verpönt wie Comics oder Fußball, die Einteilung in pädagogisch wertvoll oder eben nicht ging schnell von der Hand. Heute würde ich vieles davon infrage stellen, aber damals fand ich die Schule einfach nur klasse. Ich hatte auf den ganzen Waldorfkram gewartet wie eine durstige Pflanze auf den sanften Sommerregen. Eifrig begann ich, mein erstes Epochenheft zu gestalten, machte die ersten Versuche mit Nass-in-nass-Aquarellieren, lernte Formenzeichnen und Sprachgestaltung. Flöte spielen konnte ich zum Glück schon. Zunächst etwas unsicher, dann schon forscher tapste ich in die ersten Eurythmiestunden. Die Schule wurde mir zu einer zweiten Heimat, meine Klasse und die Lehrer:innen eine Erweiterung der Familie. Mit warmherzigen, mütterlichen Typen ebenso wie mit schrägen Vögeln, die es schließlich in fast allen Familien gibt.

In meiner alten Mini-Dorfschule bestand die Klasse aus 16 Kindern, jetzt waren wir zumindest in der Unter- und Mittelstufe fast vierzig. Dieser große Pool erwies sich jedoch als ideal, um unterschiedlichste Freund:innen zu finden, um daraus Klassenorchester zu formen, vor allem aber für die vielen Theaterprojekte. In Bonn gab es damals nicht nur das klassische Achtklass- und Zwölftklassspiel, sondern außerdem noch ein englisches oder französisches Stück in der zehnten oder elften Klasse. Gerade das berühmt-berüchtigte Achtklassspiel habe ich später auch aus der Elternperspektive als echtes Highlight der Waldorfpädagogik erlebt. Die in diesem Rahmen üblichen, aufwendigen Inszenierungen bringen alle Beteiligten an ihre Grenzen: Schüler:innen und Lehrer:innen wohnen während der letzten Probenwochen quasi in der Schule, die Eltern schalten komplett in den Versorgungsmodus, kochen und backen, was das Zeug hält, schminken, bügeln, organisieren tausend Dinge. Wenn dann am Ende 36 normalerweise höchst launische, oft unaufmerksame, meistens genervte und dünnhäutige Teenager bei den Aufführungen über sich hinauswachsen, steht wohl dennoch für alle außer Frage, dass die Sache den ganzen Aufwand wert war.
Beweglicher denken
Dass Schule im gelungenen Fall mehr vermitteln sollte als reinen Lernstoff, ist heute im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Doch Phantasie anregen, Kreativität fördern – das sagt sich so schnell. Es gibt wohl keine Schule, auch keine staatliche, die das nicht irgendwie will. An einem ganz einfachen Beispiel wird deutlich, wie so etwas an der Waldorfschule aussehen kann, und zwar in einem Bereich, in dem man es vielleicht nicht erwarten würde: beim Rechnen. An staatlichen Schulen lernen die Kinder in der ersten Klasse üblicherweise: 2 + 4 = 6. Auf diese Aufgabe – wie viel ist 2 + 4 – gibt es nur eine richtige Antwort: 6. In der Waldorfschule wird das Ganze umgedreht: Was kann 6 alles sein? Und siehe da: 6 = 2 + 2 + 2, oder 3 + 2 + 1, aber auch 3 × 2, oder 9 – 3. Eine solche Vorgehensweise fordert die Beweglichkeit heraus und zeigt, dass es viele verschiedene Wege gibt, um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Nicht zuletzt eröffnet sie unterschiedlich starken Schüler:innen jede Menge Möglichkeiten – von ganz einfachen Lösungsansätzen bis zu höchst komplizierten ist alles drin.
Was ich auf der Waldorfschule gelernt habe? Alles, was ich brauchte, um mein Abitur abzulegen, ein Hochschulstudium aufzunehmen und mit Erfolg abzuschließen. Ich habe gelernt, mir auch später im Beruf bisher unbekannte Themen selbständig zu erschließen und meiner Urteilskraft zu vertrauen. Was ich außerdem gelernt habe: dass in jedem Menschen etwas Besonderes steckt, weshalb jede und jeder einen ganz persönlichen Beitrag für diese Welt erbringen kann. Das zumindest früher weit verbreitete Vorurteil, dass Waldorfschüler:innen mit der Realität des Arbeitslebens nicht zurechtkämen und vom Leistungsdenken der Gesellschaft überfordert seien, sehe ich weder bei mir noch in meinem weiteren Umfeld bestätigt. Natürlich gibt es diese Fälle, aber sie lassen sich nicht verallgemeinern. Und vielleicht ist das Problem manchmal auch ganz anders gelagert. Vielleicht hängt es mit der immer noch viel zu starren, hierarchisch aufgebauten Arbeitswelt zusammen, in der zu wenig Platz fürs Um-die-Ecke-Denken und ungewöhnliche Lösungsansätze ist. Da ein bisschen kreatives Chaos zu stiften und auch so manches gebetsmühlenartig vorgetragene Leistungs-Credo zu hinterfragen, ist nicht das Schlechteste, was wir Waldis der Gesellschaft geben können.
(Dieser Artikel ist auch in der Januar-Ausgabe 2019 der Zeitschrift info3 erschienen.)